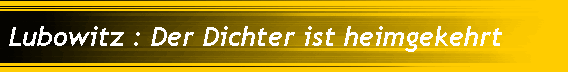
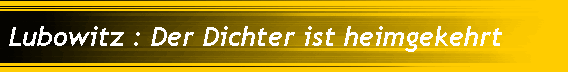 |
Lubowitz: Der Dichter ist heimgekehrt Über dem Eingang zum Schloßpark heißt ein zweisprachiges Spruchband, das zwischen zwei Bäumen festgezurrt ist, den Besucher willkommen. Viele gelbe Blätter bedecken den Boden vor einer
Ruine, an dessen verblaßter Wand aus Ziegelsteinen ein Bild hängt, das den hier geborenen Dichter Joseph Freiherr von Eichendorff zeigt. Eine Tafel rechter Hand will anschaulich machen, wie es hier einst, vor den Zerstörungen in
den letzten Kriegstagen 1945, einmal ausgesehen haben mag. Zu sehen sind eine Zeichnung jenes Schlosses, in dem der "letzte deutsche Romantiker" am 10. März 1788 geboren wurde, und eine weitere Ansicht mit dem Schloß nach
dessen letztem Umbau im Tudorstil nach 1858. Der Schloßpark mit dem berühmten "Hasengang" ist gepflegt, einige Informationsschilder, in deutscher und polnischer Sprache, geben dem Unkundigen Erläuterungen.
Noch vor elf Jahren sah es hier ganz anders aus. Gestrüpp und Unkraut wuchsen so hoch, daß man staken mußte, wollte man zu den Mauerfragmenten vordringen. Der Dichter Eichendorff war eben nicht zeitgemäß, paßte in jener Zeit als
deutschsprachiger Dichter nicht zu diesem Land. Den einstigen Schloßpark ließ die Gemeinde verwildern; mal diente er als Schuttabladeplatz, mal kippte hier die örtliche LPG 200 Tonnen Dünger aus. "Hier spürt man noch den
Krieg", schrieb Horst Bienek über seinen Besuch in Lubowitz vor 15 Jahren. Der 10. März 1988 gilt vielleicht als jener Tag, der die Wende für Lubowitz einleitete. Zum 200. Geburtstag Joseph von Eichendorffs
versammelten sich zwei Dutzend Sympathisanten des noch verfolgten Deutschen Freundschaftskreises (DFK) vor der Ruine und organisierten eine kleine Gedenkfeier. Es wurden Gedichte vorgelesen und Lieder gesungen, einiges wurde aus
dem Leben Eichendorffs erzählt. Was sich aus dieser kleinen Versammlung an einem verregneten Abend dann letztendlich ergab, kann auch als Geburtsstunde eines neuen Kultes oder eines neuen Mythos bezeichnet werden. Der älteren
oberschlesischen Generation waren die Gedichte noch geläufig: " An meinen Bruder", "0 Täler weit, o Höhen". Wer mußte sie nicht in der deutschen Schule der 1930er und 1940er Jahre auswendig lernen? In der ersten
Hälfte dieses Jahrzehnts kam eine Ortsgruppe des DFK ohne einen jährlichen "Eichendorff-Abend" nicht aus, keine DFK-Begegnungsstätte ohne eine Wandtafel mit Eichendorff-Versen. Als Motor dieser Entwicklung kann ohne
Zweifel der Lubowitzer Ortspfarrer Heinrich Rzega angesehen werden, der der katholischen Kirchengemeinde Lubowitz seit 1986 vorsteht. Der gebürtige Ratiborer versammelte die Dorfbewohner um sich und gründete zusammen mit Leonhard
Wochnik, Josef Pater und anderen im Frühjahr 1989 den "Lubowitzer Verein der Liebhaber Joseph von Eichendorffs", gemeinhin bekannt geworden als Eichendorff-Verein. Noch im Sommer desselben Jahres organisierte der Pfarrer
im Erdgeschoß des Pfarrgemeindehauses eine kleine "Eichendorff-Gedenkstube". Für damalige Zeiten war dieses, ebenso das Aufstellen zweisprachiger Schilder zwischen Ruine und Pfarrhaus, in den Augen der Bevölkerung ein
noch äußerst mutiger Schritt, der den Ort schnell bekannt werden ließ und bald Neugierige auch aus der Bundesrepublik anzog. Der verwahrloste alte Friedhof, auf dem die Eltern und Geschwister des Dichters begraben liegen, galt
Rzega als ein weiterer Schwerpunkt seiner Arbeit. Pfarrer Rzega, seine Stube und der alte Friedhof wurden berühmt, machten Lubowitz zu einen Bezugspunkt oberschlesischer Identität. Im vergangenen Jahr besuchten fast 2000
Interessenten die nur nach Voranmeldung geöffnete Eichendorff-Stube, und der Hausherr denkt daran, sie zu einer Schlesien-Stube auszubauen.Daß in der "Gemeinsamen Erklärung" des Bundeskanzlers Helmut Kohl und des
polnischen Ministerpräsidenten Tadeusz Mazowiecki vom November 1989 Lubowitz erwähnt wurde, daß eine Gedenkstätte auszubauen und einzurichten ist, bestärkte den Eichendorff-Verein in seiner Zielsetzung, den Geburtsort des
vielleicht bedeutendsten Oberschlesiers zu einem Zentrum der Kultur und Bildung der heimatverbliebenen deutschen Oberschlesier auszubauen. Der anfängliche Traum, das alte Schloß mit westdeutscher Hilfe zu rekonstruieren, es zu
einem Begegnungszentrum mit Veranstaltungsräumen und einem Eichendorff-Museum auszubauen, blieb schließlich unerfüllt. Im Juli 1991 begann der Verein damit, Grundstücke und Gebäude zu erwerben, die in der Nähe der
Ruine gruppiert liegen. Den Anfang machte der Kauf von Garagen, einer Lagerhalle und Stallungen von der örtlichen LPG. In den folgenden Jahren konnte der Besitz mit Unterstützung des Freistaates Bayern, des Bundesinnenministeriums
und vieler Spender aus dem Westen auf inzwischen acht Hektar vergrößert werden. Im vergangenen Monat erwarb der Verein noch die Milchsammelstelle, ein unansehnlicher Blickfang am Eingang zum Schloßpark. Einmal
monatlich treffen sich die Mitglieder des Eichendorff-Vereins. Dann werden anderthalb Stunden lang Probleme und neue Arbeitsvorhaben besprochen, die hauptsächlich mit der Pflege des Schloßparks und den Baumaßnahmen am alten
Wirtshaus an der ulica Zamkowa, der früheren Schloßstraße, zusammenhängen. Hier entstand in den vergangenen acht Jahren aus einem verkommenen Gebäude, das in den 80er Jahren noch zu "Tierzuchtzwecken" diente, ein
ansehnliches Haus, das zukünftig Tagungen und anderen Aktivitäten der geplanten Eichendorff-Stiftung zur Verfügung stehen wird. Der Wunsch des rührigen Vereins ist es aber, auch die anderen Gebäude in die Nutzung einzubeziehen. Aus
der Scheune ist inzwischen eine Halle für größere Veranstaltungen entstanden. In einem anderen Gebäude ist eine Sonderausstellung über Hedwig von Andechs, eine Schenkung Bayerns, untergebracht, die allerdings nur nach Voranmeldung
besucht werden kann. Im vergangenen Jahr präsentierte der Verein in Zusammenarbeit mit Herbert Jendryssek ein halbes Jahr lang eine beeindruckende Eichendorff-Ausstellung mit mehr als 200 Bild und Schautafeln. Die Stallungen des
ehemaligen Gutes würden sich besonders als Museumskomplex empfehlen. Hier könnten die Jendryssek-Sammlung und die Eichendorff-Stube aus dem Pfarrgemeindehaus zusammen einen Grundstock für ein zukünftiges Eichendorff-Museum
hergeben. Allerdings findet sich noch niemand bereit, die Modernisierung der Gebäude und die sich damit bietenden Möglichkeiten zu finanzieren. Zusammen mit dem Ende Oktober fertiggestellten Kulturzentrum im alten Wirtshaus, den
restlichen Gebäuden und dem Eichendorffschen Park könnte hier wahrlich ein beeindruckendes und attraktives oberschlesisches Zentrum für Kultur und Bildung entstehen. Der Eichendorff-Verein, der in der Region nicht
mehr als 120 Mitglieder zählt, die zusammen viele Tausende ehrenamtliche Arbeitsstunden vorweisen können, und Heinrich Rzega, der für seine Verdienste zwischenzeitlich mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet worden ist, haben in
zehn Jahren Ansehnliches geschaffen, trotz vieler Schwierigkeiten, Enttäuschungen und Rückschläge. Ihrem Idealismus ist es zu verdanken, daß der Dichter nach Lubowitz heimgekehrt ist. Arnulf Hein, Schlesien heute, Görlitz,
11/1999,
S. 12-13sheute@poczta.onet.pl |
|||
 |
|||||
 |
|||||
 |
|||||
b Bildunterschriften : Bild 1: Oberschlesier in Ratiborer Tracht vor den Ruinen des Eichendorff-Schlosses. Bild 2: Zum Geburtstag des Dichters treffen sich alljährlich tausende Oberschlesier in Lubowitz zu einem deutschsprachigen Gedenkgottesdienst und Lesungen. Bild 3: Pfarrer Heinrich Rzega diskutiert mit westdeutschen Studenten vor einer Texttafel über Joseph von Eichendorff.
|
|||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
| [Home] [Biographie] [Werke] [Gedichte] [Bücher] [DFK in Lubowitz] [Eichendorff Chor] |